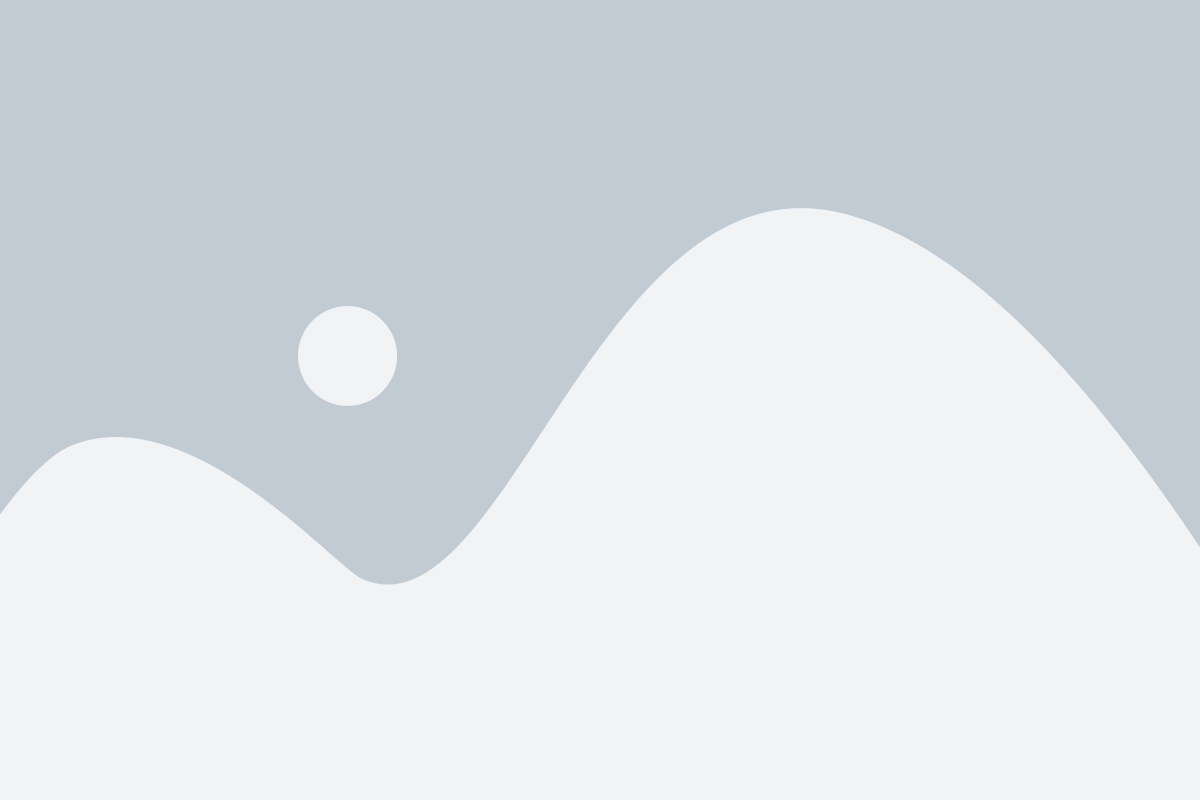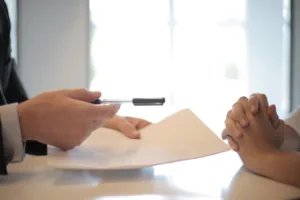Inhaltsverzeichnis
ToggleEin Hinweis an alle Betreiber von elektrischen Anlagen und Geräten: Der E-Check ist ein anerkanntes Prüfverfahren, das Ihre Verantwortung als Arbeitgeber oder Gebäudebetreiber unterstützt und dokumentiert. Er hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen und Rechtssicherheit zu schaffen.
1. Einleitung: Sicherheit ist prüfbar
Elektrische Energie ist unverzichtbar, birgt jedoch Gefahren, wenn sie unsachgemäß verwendet oder wenn Anlagen nicht regelmäßig geprüft werden. Der sogenannte E-Check bietet ein normgerechtes Prüfverfahren für elektrische Installationen und Geräte – sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich.
Für Unternehmen ist der E-Check eine anerkannte Möglichkeit, die Pflichten aus Vorschriften wie der DGUV V3, der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und den DIN VDE-Normen nachweisbar zu erfüllen.
2. Was ist der E-Check?
Der E-Check ist eine freiwillige, aber in vielen Fällen empfohlene Prüfung von elektrischen Anlagen und Geräten. Er wird von zertifizierten Elektrofachbetrieben durchgeführt und orientiert sich an den gültigen technischen Normen – insbesondere der DIN VDE 0100, VDE 0701/0702 und VDE 0105-100.
Der Begriff “E-Check” ist eine eingetragene Marke des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) und kennzeichnet eine qualitätsgesicherte Elektroprüfung.
3. Für wen ist der E-Check relevant?
Obwohl der E-Check keine gesetzliche Pflichtprüfung im engeren Sinne ist, empfiehlt sich seine Durchführung ausdrücklich, insbesondere in folgenden Fällen:
-
In Unternehmen zur Erfüllung der Betreiberpflichten
-
In Vermietungsobjekten zur Absicherung gegenüber Mietern
-
In öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder Pflegeheimen
-
Bei Photovoltaik-Anlagen, E-Ladestationen, Wärmepumpen etc.
-
Zur Dokumentation gegenüber Versicherern im Schadensfall
Für Unternehmen ersetzt der E-Check nicht zwingend die DGUV V3 Prüfung, kann aber nachweislich die gleichen Inhalte abdecken, sofern normgerecht durchgeführt.
4. Was wird beim E-Check geprüft?
Der Umfang der Prüfung richtet sich nach der Art der Anlage oder Geräte. Typische Prüfobjekte sind:
4.1 Elektrische Installationen (ortsfest)
-
Verteilungen, Schaltschränke, Steckdosen, Lichtinstallationen
-
RCD-Funktionstest (Fehlerstromschutz)
-
Isolations- und Schleifenwiderstandsmessung
4.2 Geräteprüfung (ortsveränderlich)
-
Elektrische Handgeräte, Bürogeräte, Haushaltsgeräte
-
Messung von Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Berührungsspannung
-
Sichtprüfung auf äußere Mängel, z. B. beschädigte Gehäuse, Stecker, Leitungen
4.3 Zusatzbereiche
-
E-Mobilitätsinfrastruktur (Wallboxen)
-
PV-Anlagen (Generatorprüfung, Blitzschutz, Erdung)
-
Überspannungsschutzsysteme
5. Welche Normen liegen dem E-Check zugrunde?
Der E-Check orientiert sich an den allgemein anerkannten Regeln der Technik und insbesondere an:
-
DIN VDE 0100-600 (Erstprüfung von Installationen)
-
DIN VDE 0105-100 (Wiederholungsprüfung)
-
TRBS 1201 und 1203 (Technische Regeln für Betriebssicherheit)
Wichtig: Die Durchführung erfolgt ausschließlich durch Elektrofachkräfte mit entsprechender Qualifikation und Messausstattung.
6. Rechtliche Relevanz des E-Checks
Auch wenn der Begriff „E-Check“ nicht wörtlich in der Gesetzgebung auftaucht, hat er eine hohe rechtliche Bedeutung:
-
Schadensvorsorge: Versicherungen erkennen den E-Check oft als Nachweis an, um Fahrlässigkeit auszuschließen.
-
Beweislastumkehr: Im Schadenfall schützt die Dokumentation durch den E-Check den Betreiber.
-
Arbeitsrecht: Unternehmer dokumentieren mit dem E-Check ihre Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitenden.
-
Brandschutz: Viele Sachverständige empfehlen den E-Check im Rahmen des organisatorischen Brandschutzes.
7. Wie oft sollte der E-Check erfolgen?
Die Prüfintervalle richten sich nach Nutzung, Umgebung und Art der Anlage. Richtwerte sind:
| Bereich | Empfohlenes Intervall |
|---|---|
| Bürogeräte, einfache Nutzung | Alle 2 Jahre |
| Werkstattgeräte, raue Umgebung | Alle 6–12 Monate |
| Photovoltaik, E-Mobilität | Jährlich bis alle 2 Jahre |
| Allgemeine Installationen | Alle 4 Jahre |
Die genauen Fristen sollten durch eine Gefährdungsbeurteilung bestimmt werden.
8. Was kostet ein E-Check?
Die Kosten hängen vom Umfang der Anlage, Anzahl der zu prüfenden Geräte und vom Anbieter ab. Als Richtwert gilt:
-
Kleine Betriebe (bis 30 Geräte): ab ca. 250–400 Euro
-
Mittelständische Unternehmen: mehrere hundert bis tausend Euro
-
Große Betriebe / Industrieanlagen: individuelle Kalkulation
Tipp: Oft lassen sich E-Check und DGUV V3 Prüfung kombinieren, um Synergien zu nutzen.
9. Dokumentation und Prüfprotokolle
Nach dem E-Check erhält der Betreiber:
-
Geprüfte Geräte mit Prüfplakette
-
Protokolle mit Messwerten
-
Empfehlungen für Mängelbeseitigung
-
Termin für Wiederholungsprüfung
Diese Dokumentation dient bei Kontrollen, Audits oder im Versicherungsfall als rechtssicherer Nachweis.
10. Fazit: Der E-Check ist verantwortungsvolle Vorsorge
Der E-Check schafft nicht nur Rechtssicherheit – er verhindert Stromunfälle, technische Defekte, Ausfälle und Schäden. Unternehmen, Vermieter, öffentliche Träger und Privatpersonen profitieren gleichermaßen.
Wer regelmäßig prüft, handelt vorausschauend, verantwortungsbewusst – und gesetzeskonform.