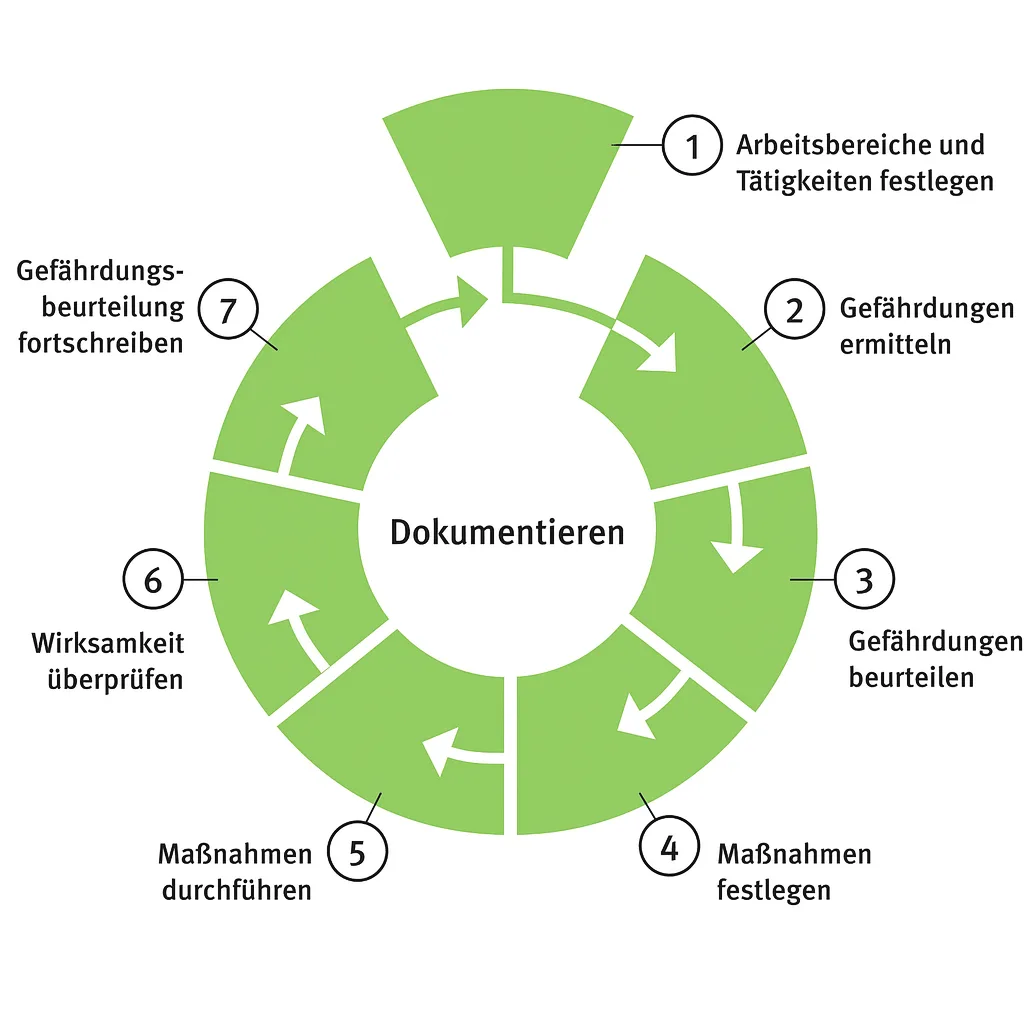Inhaltsverzeichnis
ToggleEin Hinweis an alle Arbeitgeber und Betreiber von Arbeitsmitteln: Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Steuerungsinstrument für Arbeitssicherheit und Prüfpflichten. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben – und bildet die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen wie Prüffristen, Instandhaltungspläne oder Betriebsanweisungen.
1. Einleitung: Gefährdungen erkennen, bevor etwas passiert
Die sichere Verwendung von Maschinen, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Geräten ist nur möglich, wenn potenzielle Gefährdungen vorher erkannt und bewertet werden. Dazu verpflichtet die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) alle Arbeitgeber.
Im Zentrum steht die Gefährdungsbeurteilung – sie ist keine Option, sondern eine gesetzliche Pflicht (§ 3 BetrSichV) und Voraussetzung für den sicheren Betrieb jedes Arbeitsmittels.
2. Was ist eine Gefährdungsbeurteilung?
Eine Gefährdungsbeurteilung ist die systematische Ermittlung und Bewertung möglicher Gefährdungen, die beim Bereitstellen und Benutzen von Arbeitsmitteln auftreten können.
Sie berücksichtigt:
das jeweilige Arbeitsmittel
die Umgebung
die Nutzungsdauer und -häufigkeit
die Qualifikation der Benutzer
mögliche Fehlerquellen oder Fehlbedienungen
Ziel ist es, notwendige Schutzmaßnahmen abzuleiten – und die Prüffristen, Prüfart und Prüfpersonen rechtskonform festzulegen.
3. Gesetzlicher Hintergrund
Die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung ergibt sich aus:
§ 3 BetrSichV: Gefährdungsbeurteilung vor Bereitstellung und Verwendung von Arbeitsmitteln
§ 5 ArbSchG: Allgemeine Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung aller Tätigkeiten
TRBS 1111: Technische Regeln zur Durchführung der Beurteilung
Unternehmen, die keine oder nur lückenhafte Gefährdungsbeurteilungen vorweisen können, riskieren Bußgelder, Haftung oder den Verlust des Versicherungsschutzes.
4. Wann ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen?
Die Beurteilung ist erforderlich:
vor der ersten Bereitstellung eines Arbeitsmittels
bei wesentlichen Änderungen (z. B. Umbau, Standortwechsel)
nach Unfällen oder Störungen
regelmäßig, um Aktualität sicherzustellen
5. Wie läuft die Gefährdungsbeurteilung ab?
Ein standardisierter Ablauf umfasst typischerweise:
Erfassung des Arbeitsmittels (Art, Einsatzbereich, Umgebung)
Identifikation möglicher Gefährdungen (elektrisch, mechanisch, thermisch etc.)
Risikobewertung (Schwere und Eintrittswahrscheinlichkeit)
Festlegung von Schutzmaßnahmen (technisch, organisatorisch, personell)
Bestimmung von Prüffristen und Prüfart
Dokumentation
Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung
Die Gefährdungsbeurteilung muss nachvollziehbar dokumentiert und bei Kontrollen vorgelegt werden können.
6. Wer darf eine Gefährdungsbeurteilung durchführen?
Grundsätzlich ist der Arbeitgeber verantwortlich. Die Durchführung kann delegiert werden an:
Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Elektrofachkräfte
Betriebsingenieure
externe Dienstleister mit Sachkunde
Wichtig ist, dass die beauftragte Person über fachliche Eignung und Kenntnis der betrieblichen Gegebenheiten verfügt.
7. Was sind typische Gefährdungen bei elektrischen Betriebsmitteln?
Stromschlag durch beschädigte Leitungen
Brandgefahr durch Überlastung oder mangelhafte Schutzmaßnahmen
mechanische Gefährdung bei rotierenden Teilen
Stolperfallen durch Kabelverlegung
unzureichende Einweisung oder Fehlbedienung
Diese Gefährdungen sind Grundlage für Schutzmaßnahmen – etwa die regelmäßige Prüfung nach DGUV Vorschrift 3.
8. Wie oft muss die Gefährdungsbeurteilung aktualisiert werden?
Es gibt keine festen Fristen, aber Anlässe zur Überprüfung:
Änderungen am Arbeitsmittel oder Arbeitsort
Neue Erkenntnisse über Gefährdungen (z. B. Unfallberichte)
Neue Vorschriften oder technische Regeln
Änderung der Nutzungsintensität
In der Praxis empfiehlt sich eine Überprüfung mindestens alle 1–2 Jahre.
9. Häufige Fehler in der Praxis
Keine schriftliche Dokumentation vorhanden
Prüffristen „geschätzt“ statt bewertet
Einmalige Beurteilung, keine Aktualisierung
Maßnahmen werden nicht umgesetzt
Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt
Eine formal vorhandene, aber inhaltlich unbrauchbare Gefährdungsbeurteilung bietet keinen Schutz im Haftungsfall.
10. Fazit: Die Gefährdungsbeurteilung ist das Fundament jeder Prüforganisation
Wer Arbeitsmittel bereitstellt, muss wissen, welche Risiken bestehen – und wie sie zu minimieren sind. Die Gefährdungsbeurteilung ist dafür das zentrale Werkzeug.
Sie hilft, rechtssicher zu handeln, Prüfintervalle begründet festzulegen und Schutzmaßnahmen gezielt umzusetzen.
Kurz gesagt: Keine Prüfung ohne Bewertung – keine Sicherheit ohne System.